Schon länger währt sie an, die Vorfreude auf das kommende verlängerte Wochenende. Schon beim Einreichen ködert der Titel Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm. Wo, wenn nicht dort? Erst später begreife ich, dass dieses Dort eine der obersten Adressen für den internationalen Dokumentarfilm ist. Das Duett mit dem Animationsfilm öffnet einen weiteren Zugang für das Sehen Was Ist – wie es ein Banner in der Altstadt so schön bezeichnet. Und das vereint die Kurz-, wie die Langfilme im Programm, egal ob real oder animiert. Wobei Letztere sich hier offensichtlich auch für das Rennen der Academy Awards qualifizieren können, sofern am Ende die Goldene Taube das will. Kollegen klopfen mir im Vorfeld auf die Schulter, wünschen und versprechen ein tolles Festival.

Der Einladung und den Emails folgend, finde ich mein Hotel, das mich gleichermaßen irritiert, wie wundern lässt. Der Check-In via Smartphone, keine Rezeption im klassischen Sinn. Eine offene Wohnzimmer-Lobby, ein Billardtisch, der Flat-Screen mit Playstation, eine mit Halloween-Kürbissen geschmückte Küchenzeile samt Bar und Touchscreen-Kaffeemaschine. Jede Tür des Hauses kann mit der Webapplikation entsperrt werden. Vom Nachteingang bis zur Panorama Bibliothek im siebten Stock. Was einige Male dazu führt, dass man mit anderen Gästen am Haupteingang zusammentrifft, die auch nach der einen, wichtigen Email suchen, die den Link zum Portal enthält. Und endlich, ja: der Sesam öffnet sich.
Die Webseite des Festivals ist sauber strukturiert, der Kalender prall mit Screenings, Ausstellungen und Industry Events. Aufgrund meiner späteren Anreise schaffe ich nur eines der vier Screenings, wo Lina gezeigt wird. Beim Guest Office erhalte ich die dazugehörige Eintrittskarte, die bereits auf den Akkreditierungsausweis geheftet wurde. “Welcome. Enjoy the festival.” Zwei Stunden später sitze ich schon im CineStar Megaplex und sehe bereits den ersten Dokumentarfilm Welded Together (Anastasiya Miroshnichenko, FR/NL/BE 2025), Ganz nah begleitet der Film eine zwanzigjährige Schweißerin in Belarus, die beschließt den Kontakt zu ihrer Mutter wiederherzustellen. Eine Zerreißprobe zwischen ihrer eigenen Kindheit im Waisenhaus und der Entscheidung, die zweijährige Halbschwester aus dem Sumpf des Alkoholkonsums ihrer Mutter zu befreien.
Später am Abend folgt The Woman Who Poked the Leopard (Patience Nitumwesiga, Uganda 2025). Die Politdoku beginnt mit einem Gedicht der Protagonistin Stille Nyanzi, die dem scheindemokratischen Präsidenten des Landes zum Geburtstag provoziert. Er hätte doch lieber im Scheidenpilz seiner gebärenden Mutter ersticken sollen, als die elementaren Menschenrechte und die Verfassung seit vierzig Jahren zu vergewaltigen. So nur ein Vers der brachialen Abrechnung, die ihr einen neunmonatigen Gefängnisaufenthalt einbrockte. Als Mutter dreier Kinder und Universitätsprofessorin besitzt Nyanzi die Sprachfertigkeit in manipulierten TV-Interviews, Hausbesetzungen und Polizeiuntersuchungen die Menschen zu ermutigen, zu aktivieren und Haltung und Stolz zu bewahren, Eine Kraft, die aus dem Näheverhältnis von privaten und bedrängenden Szenen, zum Schaudern und Schmunzeln bewegt. So hochkarätig die Umsetzung, so tatsächlich die Dringlichkeit, so unverschämt die Scheinheiligkeit des totalitären Regimes. Die Regisseurin ist anwesend und schildert die Dreharbeiten, den Weg zum Vertrauen der Kinder, die Brisanz, das Filmmaterial immer wieder durch Kuriere aus dem Land schicken zu müssen. – Beim Q’n’A möchte es eine Frau aus Brasilien etwas genauer wissen. Sie kenne ähnliche Szenarien aus ihrer Heimat und hier in Deutschland sind wir uns ja einig. Aber wie möchte man den Film und diese Sichtweisen in Uganda an die Menschen bringen? – Die Regisseurin gesteht, dass sie derzeit selbst in Europa Schutz gesucht hat, aber es werde bereits an Underground Screenings gearbeitet. Es wird höchstwahrscheinlich nicht leicht werden.

Spätestens jetzt wird mir bewusst, in welch hochkarätiger Gesellschaft sich Lina hier in Leipzig befindet. Und die bereits reservierten Filme werden das Niveau halten. Am Tag darauf folgt das bereits erzählte Interview mit den DOK Spotters, um fünfzehn Uhr dann die Kurzfilmrolle Zusammen sind wir weniger allein, wo Lina in Gesellschaft mehrerer gemischter Arbeiten ganz am Ende platziert ist. Eine großartige Entscheidung in der Programmierung. Eingangs nehme ich, wie gewünscht, Kontakt zur Saalregie auf, um mit der Moderation bekannt zu werden. Wir schließen uns kurz. Drei der sechs Filmemacher:innen sind anwesend. Wir sprechen jeweils direkt nach jedem Film. Alles klar. – Das Programm ist wieder vielschichtig, politisch aufwühlend, sowie poetisch und gespickt mit spannenden Kunstgriffen in Narration und Darstellung. Die Spannung steigt, als die mir bekannte Musik von Clemens startet. Die Projektion ist gestochen scharf, der Ton genau am richtigen Level auf ausgezeichneten Lautsprechern. Ich spüre die Sitznachbarn atmen, sich die Augen wischen oder gar mal summend bejahen, Sie sind alle dabei. Der gesamte Saal ist ausverkauft. Sicher einige hundert Menschen.
Marie Ketzscher bittet mich nach vor und steht mir mit glasigen Augen gegenüber. Sie bittet mich, die Herangehensweise zu schildern. Wie es zu dem Film kam und wie er sich entwickelt habe. Ich folge dem Vorbild einer Vorrednerin und wechsle auf Englisch. Nach anfänglichem Stammeln und dem Geständnis, dass es mir selbst grad schwer fällt, mich zu sammeln, fangen die richtigen Worte zu sprudeln an. Oft nickt ein Gesicht im Publikum, mache hören gebannt zu oder sind in Gedanken versunken. Es wird gelobt, dass die Bildsprache so taktvoll gewählt ist und man möchte wissen, wie die Bild-Ton-Beziehung entstand, was zuerst da war. Und ich spüre die Animator:innen im Raum, die mir stillschweigend zustimmen:”Even though there were some later shifts in the editing, sound is part of the process from the very beginning.” – Speziell in diesem Kontext, wo doch die Aussagen der Betroffenen das Narrativ vorantreiben. Diesen Wiederum gilt die größte Hochachtung, denn ihre ehrlichen und nahbaren Aussagen erzeugen die Gewichtigkeit des Films und erzählen, wovon man die Bandbreite selten zu hören bekommt.
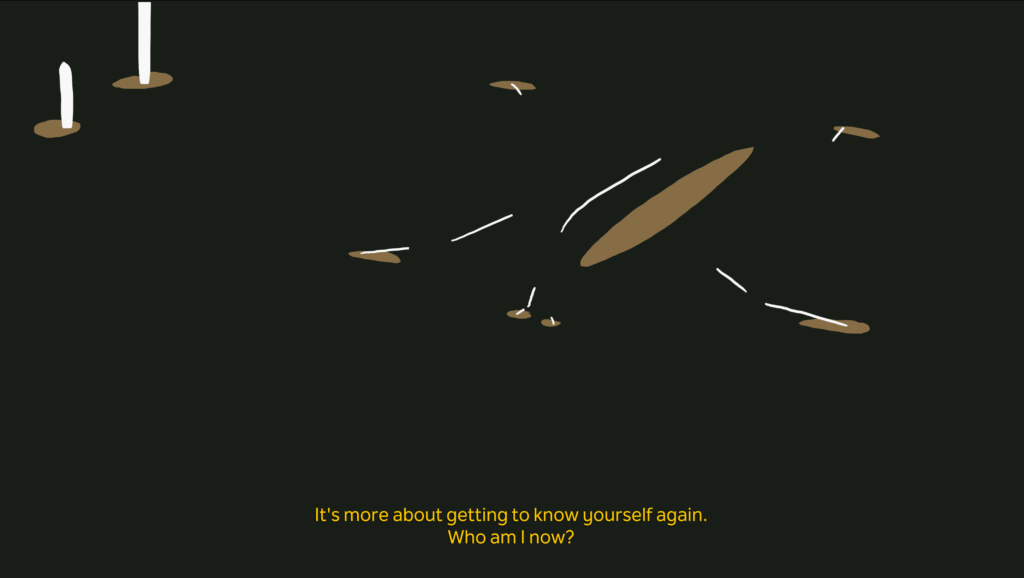
Eine Frau in der zweiten Reihe möchte die Intentionen hinter dem Bild mit dem Wasserläufer erfahren und läutet damit das Ende des Publikumsgesprächs ein. Derartige Traumata verändern die Menschen und hinterlassen ein Gefühl einer dünnen Oberfläche, eines fragilen Untergrunds, where you can easily loose grip on … Auch die untrennbare Dualität von Leben und Tod und meine persönliche Tendenz zu einer animistischen Weltanschauung seiend damit verbunden.
Die Zeit für unseren Programmpunkt neigt sich dem Ende zu und der Applaus tut gut. Die Spannung fließt ab und die Freude überwiegt wieder. Eine Frau kommt mir an den Treppen entgegen. So Vieles hätte ihr der Film gezeigt und sie werde viel für ihre eigene Arbeit als Animatorin daraus mitnehmen. Sie kenne natürlich auch Betoffene und hätte das Phänomen auch lange nicht gekannt. Es werde viel zu wenig darüber gesprochen. Sie lebT derzeit in Frankreich, ihre Wurzeln seinen aber in Venezuela. Wir wünschen uns noch schöne Festivaltage. Beim Ausgang spricht mich die Saalregie an und fragt nach weiteren Aufführungen und wo man den Film sonst noch sehen könnte. Ich verweise auf die Projektseite, mit dem Versprechen, jede Anfrage mit einem Link zu beantworten. Mit der unbedingten Bitte, es weiterzuerzählen. Die jünger Kollegin meint gar, dass sie sich wünsche, dass Lina zur Pflichtlektüre in unserer Gesellschaft werde. Jede:r sollte so etwas gesehen und gehört haben. So essenziell sähe sie den Wert der Offenheit und die therapeutische Wirkung. – Und ja, der Wasserläufer gefällt ihr auch super und sie entlässt mich mit dem Wink, dass das Motiv doch ein wirklich tolles Tattoo abgeben würde.
Ich blicke zurück auf ein programmatisch und organisatorisch unglaublich rundes Festival. Leipzig, ihr habt schwer beeindruckt und inspiriert. Genauso, wie die vielen weiteren Filmgespräche und Produktionen. Vielen herzlichen Dank für die Einladung!
DOK Leipzig – Internationales Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm – www.dok-leipzig.de„Mir hat das erst passieren müssen, dass ich wusste, dass es ‚normal‘ ist.“ Dieser Satz einer Protagonistin bringt auf den Punkt, wie unsere Gesellschaft mit ungeborenen und früh verstorbenen Kindern umgeht: Sternenkinder sind omnipräsent (jede vierte Mutter hat ein Kind verloren) und doch abwesend. Uns fehlen die Vokabeln, die Sensibilität und die Stille, um den Eltern die Trauer zu ermöglichen.
Irina Rubina
Remo Rauschers animierter Dokumentarfilm konfrontiert uns mit ebendieser Unfähigkeit. Hier sprechen zwanzig trauernde und mit Trauer befasste Menschen: Sie denken laut nach, ringen um Worte, betrachten den Schmerz aus unterschiedlichen Perspektiven, entdecken Würde und Kraft darin und helfen uns so, das Tabu zu überwinden. Sie wehren sich dagegen, ein „Fehler im System“ zu sein, die Sprachlosigkeit hinzunehmen. Die Dunkelheit in Rauschers Film ist ambivalent und auf allen Ebenen spürbar: Sie wirkt sogartig und zugleich fürsorglich. Sie ist großzügig und schenkt uns Momente von Schönheit, Demut und Hoffnung. Die 2D-Animationen in gedeckten Farben auf dunklem Hintergrund bleiben abstrakt, skizzenhaft und zurückhaltend – ein Ausdruck von Feingefühl und Respekt. Nur gelegentlich lenken sie Aufmerksamkeit auf sich, während die Stimmen viel Raum bekommen und sich angstfrei entfalten können. Dieser Film öffnet einen Raum zum Trauern, den die Gesellschaft noch nicht bieten kann.

